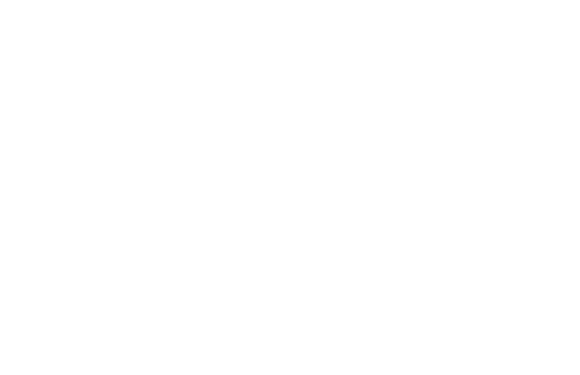Montage
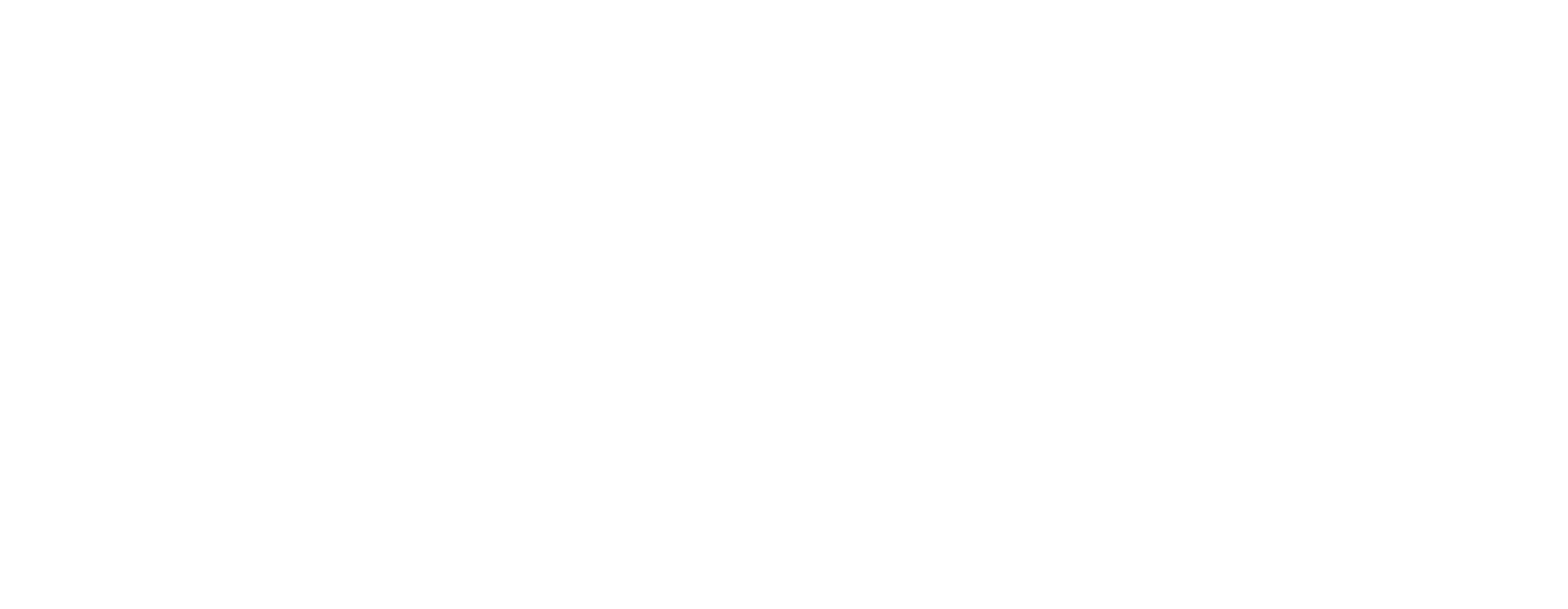
Die sachgemäße Montage von herkömmlichen Fenstern erfordert bereits ein hohes Maß an Fachwissen und handwerklichem Können. Jedoch wird die Aufgabe um ein Vielfaches anspruchsvoller, wenn es darum geht, bodentiefe Fenster und Türen zu planen, zu montieren und abzudichten. Ebenso erfordert die Montage absturzsichernder Fenster, Türen und Verglasungen ein profundes Verständnis von Baukonstruktionen und Sicherheitsvorschriften.
Die Installation von einbruchhemmenden Bauelementen in hochwärmedämmenden Wänden erfordert wiederum ein spezifisches Fachwissen im Bereich der Sicherheitstechnik und Wärmeisolierung.
Die Installation von einbruchhemmenden Bauelementen in hochwärmedämmenden Wänden erfordert wiederum ein spezifisches Fachwissen im Bereich der Sicherheitstechnik und Wärmeisolierung.
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.
Front matter, or preliminaries, is the first section of a book and is usually the smallest section in terms of the number of pages. Each page is counted, but no folio or page number is expressed or printed, on either display pages or blank pages.
Gliederung
1. Vorwort
2. Bodentiefe Fenster Richtig montieren
3. Absturzsichernde Bauelemente
4. Fenstermontage nach der aktuellen DIN 4108 und 4109
5. Bewertung von Wärmebrücken mit Ψ- (Psi-) und fRsi- Wert
6. Wärmetechnische Optimierung beim Fenstertausch
7. Die neue DIN 4109, Schallschut
8. Fenstermontage in hochwärmedämmendem Mauerwerk
2. Bodentiefe Fenster Richtig montieren
3. Absturzsichernde Bauelemente
4. Fenstermontage nach der aktuellen DIN 4108 und 4109
5. Bewertung von Wärmebrücken mit Ψ- (Psi-) und fRsi- Wert
6. Wärmetechnische Optimierung beim Fenstertausch
7. Die neue DIN 4109, Schallschut
8. Fenstermontage in hochwärmedämmendem Mauerwerk
1. Vorwort
Die Fenstertechnik hat sich durch die energetischen Anforderungen enorm entwickelt und auch die Montagetechnik muss diesen Anforderungen gerecht werden. Die Bauphysik, Gebrauchstauglichkeit, Wirtschaftlichkeit und ein vertretbarer Wartungsaufwand werden bei der Planung oft nicht ausreichend genug berücksichtigt oder der ausführenden Firma übertragen. Hierzu gehören auch die sorgfältige Planung der Baukörperanschlüsse, ins-besondere bei der energetischen Sanierung und komplexen Fällen wie bei bodentiefen Verglasungen/Bauelementen sowie barrierefreien Türen.
Die Montage moderner Fenster und Türen ist deshalb eine anspruchsvolle Planungsauf- gabe, auch weil höhere Fenstergewichte, größere Abmessungen, geringere Tragfähigkei- ten hochwärmedämmender Außenwände sowie die Zunahme an Sonderanforderungen (Einbruchhemmung, Absturzsicherung, Barrierefreiheit etc.) zu berücksichtigen sind. Ins-besondere die Befestigung bodentiefer Fensterelemente ohne separate Absturzsicherung aus Metall oder Paneelen ist eine Aufgabe die gemeinsam vom Planer und ausführender Firma frühzeitig angegangen werden muss.
Die Montage moderner Fenster und Türen ist deshalb eine anspruchsvolle Planungsauf- gabe, auch weil höhere Fenstergewichte, größere Abmessungen, geringere Tragfähigkei- ten hochwärmedämmender Außenwände sowie die Zunahme an Sonderanforderungen (Einbruchhemmung, Absturzsicherung, Barrierefreiheit etc.) zu berücksichtigen sind. Ins-besondere die Befestigung bodentiefer Fensterelemente ohne separate Absturzsicherung aus Metall oder Paneelen ist eine Aufgabe die gemeinsam vom Planer und ausführender Firma frühzeitig angegangen werden muss.
2. Bodentiefe Fenster und Türen richtig montieren
Beim Einbau von Fenstern, Außentüren und Fassaden sind der winterliche und sommerliche Wärmeschutz (EnEV), der Feuchteschutz (Tauwasser, Schlagregen, DIN 4108,), der Schallschutz (DIN 4109), der Brandschutz (DIN 4102) sowie eine sichere Befestigung im Gebäude zu beachten. In der EnEV 2016 werden Anforderungen an die Dichtheit der Gebäudehülle in § 6 Dichtheit, Mindestluftwechsel gestellt, in dem es heißt „Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig und entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist". Die Planung und Nachweisführung ist Aufgabe des Planers und umfasst auch den feuchtetechnischen Nachweis, der in der Regel über die Bestimmung des f RSI Faktors erfolgt.
Nach Muster-/Landesbauordnung (MBO/LBO) und der VOB/C ATV (Bsp. DIN18360 Me-
tallbauarbeiten) heißt es „... die Verankerungen der Bauteile im Baukörper sind so anzu-
bringen, dass das Übertragen der Kräfte in den Baukörper gesichert ist". Hierzu müssen
für Planung und Ausschreibung die notwendigen Zeichnungen und Angaben zum Objekt, Nutzungszweck, der Bauweise sowie der Wandkonstruktion bzw. -baustoffe vorhanden sein. Weiterhin sind Angaben zur Einbausituation, der Einbauhöhe, der Einbauebene so- wie den zu berücksichtigenden Lasten und Bauwerksbewegungen zu machen.
Nach Muster-/Landesbauordnung (MBO/LBO) und der VOB/C ATV (Bsp. DIN18360 Me-
tallbauarbeiten) heißt es „... die Verankerungen der Bauteile im Baukörper sind so anzu-
bringen, dass das Übertragen der Kräfte in den Baukörper gesichert ist". Hierzu müssen
für Planung und Ausschreibung die notwendigen Zeichnungen und Angaben zum Objekt, Nutzungszweck, der Bauweise sowie der Wandkonstruktion bzw. -baustoffe vorhanden sein. Weiterhin sind Angaben zur Einbausituation, der Einbauhöhe, der Einbauebene so- wie den zu berücksichtigenden Lasten und Bauwerksbewegungen zu machen.
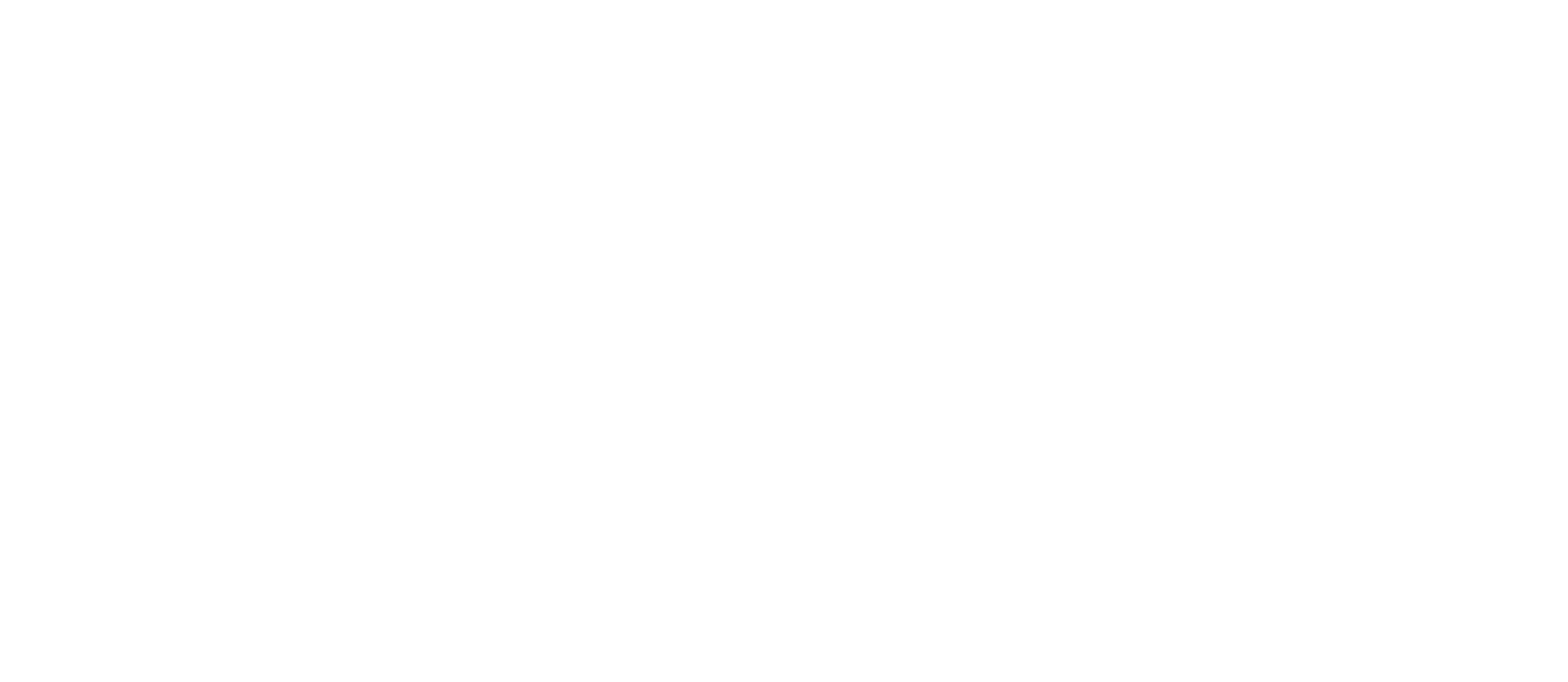
3. Absturzsichernde Bauelemente
Bauelemente und Verglasungen übernehmen die Funktion einer absturzsichernden Umwehrung (Geländer), wenn diese unterhalb der Brüstungshöhe eingebaut werden und einem bestimmten Höhenunterschied zwischen Fußboden (Raumseite) und angrenzender Geländeoberkante (Außenseite) überschreiten. Die maßgeblichen Brüstungshöhen (zwischen 0,8 m und 1,2 m) und Höhenunterschiede > 1,0 m (in Bayern > 0,5 m) sind in den Landesbauordnungen der Länder geregelt. Es gelten baurechtliche Anforderungen an die Absturzsicherung des Elements inkl. der verwendeten Befestigungsmittel zum Baukörper.
Diese müssen „geregelt" sein oder einen Verwendbarkeitsnachweis (abZ oder ETA, abP,
ZiE) 11 haben. Es sind zwei Nachweise zur Tragsicherheit zu führen (statische und stoßartigen Einwirkungen) einschließlich der Verankerung im tragenden Baugrund. Das System sollte als „Befestigungskette" verstanden werden, die vom Glas über den Fensterflügel/rahmen bis zum Mauerwerk reicht. Das gilt auch, wenn Geländer am Fensterrahmen und nicht in der Wand befestigt sind.
Diese müssen „geregelt" sein oder einen Verwendbarkeitsnachweis (abZ oder ETA, abP,
ZiE) 11 haben. Es sind zwei Nachweise zur Tragsicherheit zu führen (statische und stoßartigen Einwirkungen) einschließlich der Verankerung im tragenden Baugrund. Das System sollte als „Befestigungskette" verstanden werden, die vom Glas über den Fensterflügel/rahmen bis zum Mauerwerk reicht. Das gilt auch, wenn Geländer am Fensterrahmen und nicht in der Wand befestigt sind.
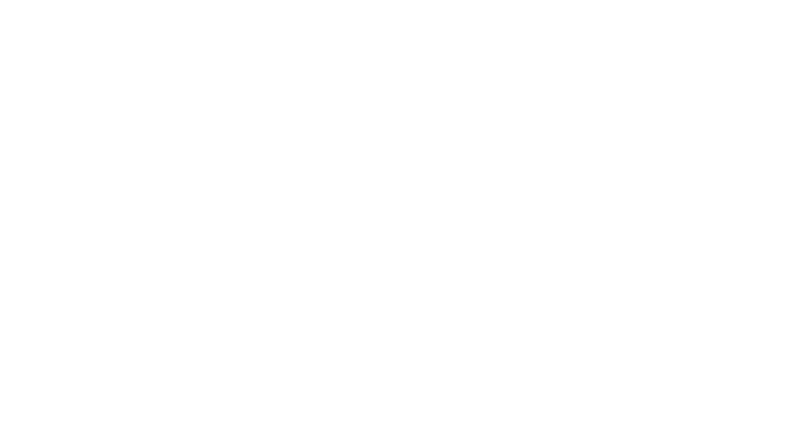
Die tragenden Teile der absturzsichernden Konstruktion einschließlich der Befestigung
zum Baukörper müssen den einschlägigen technischen Regeln entsprechen. Abhängig
von der Kategorie der absturzsichernden Verglasung nach DIN 18008-4 sind hinsichtlich der Befestigung, je nach Lage, unterschiedliche Einwirkungen zu berücksichtigen. Gleiches gilt sinngemäß für die Befestigung einer absturzsichernden Brüstung (französischer Balkon) am Fensterelement.
Beim Nachweis ist die Tragfähigkeit (= Widerstand) des gewählten Befestigungselements den ermittelten Lasten gegenüberzustellen und Befestigungselemente zu verwenden sind, die nach eingeführten technischen Baubestimmungen rechenbar sind, oder die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder europäische technische Bewertung (ETA) haben, bei der auch die verwendeten Wandbauarten und -baustoffe beschrieben sind.
Hierbei sollten auch Angaben zum Einsatz in der Leibung sowie Verarbeitungsvorgaben
für das Befestigungselement (Bohrverfahren, Bohrerdurchmesser, Bohrlochtiefe, Ausblasen der Bohrlöcher etc). vorhanden sein. Alternativ kann der Nachweis im Rahmen einer Zustimmung im Einzelfall auf Basis entsprechender Prüfungen geführt werden (ZIE). Für die Praxis bedeutet dies, dass Dübelverankerungen von einem Planer bemessen werden müssen und die Montage durch geschultes Personal auszuführen ist.
zum Baukörper müssen den einschlägigen technischen Regeln entsprechen. Abhängig
von der Kategorie der absturzsichernden Verglasung nach DIN 18008-4 sind hinsichtlich der Befestigung, je nach Lage, unterschiedliche Einwirkungen zu berücksichtigen. Gleiches gilt sinngemäß für die Befestigung einer absturzsichernden Brüstung (französischer Balkon) am Fensterelement.
Beim Nachweis ist die Tragfähigkeit (= Widerstand) des gewählten Befestigungselements den ermittelten Lasten gegenüberzustellen und Befestigungselemente zu verwenden sind, die nach eingeführten technischen Baubestimmungen rechenbar sind, oder die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder europäische technische Bewertung (ETA) haben, bei der auch die verwendeten Wandbauarten und -baustoffe beschrieben sind.
Hierbei sollten auch Angaben zum Einsatz in der Leibung sowie Verarbeitungsvorgaben
für das Befestigungselement (Bohrverfahren, Bohrerdurchmesser, Bohrlochtiefe, Ausblasen der Bohrlöcher etc). vorhanden sein. Alternativ kann der Nachweis im Rahmen einer Zustimmung im Einzelfall auf Basis entsprechender Prüfungen geführt werden (ZIE). Für die Praxis bedeutet dies, dass Dübelverankerungen von einem Planer bemessen werden müssen und die Montage durch geschultes Personal auszuführen ist.
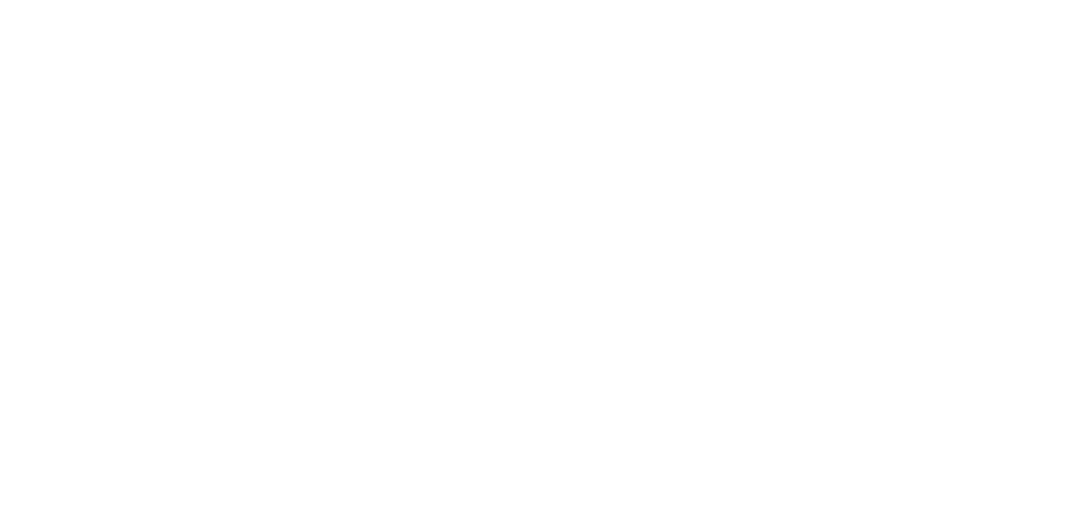
4. Fenstermontage nach der aktuellen DIN 4108 und DIN 4109
Im Kontext von energieeffizienten Gebäuden haben die Wände und Bauelemente einen hohen energetischen Standard erreicht, wodurch der Anschluss an den Baukörper zur kritischen Stelle wird. In diesem Zusammenhang gewinnt eine gut durchdachte Montageplanung an Bedeutung. Insbesondere bei der energetischen Sanierung von Gebäuden ist eine sorgfältige Montageplanung unabdingbar, da ohne diese eine Umsetzung der Pariser Klimaziele nicht möglich ist.
5. Bewertung von Wärmebrücken mit Ψ(Psi) und fRsiWert
Die Bewertung von Wärmebrücken mittels Ψ- (Psi-) und fRsi-Werten ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung von Gebäuden mit hohem energetischen Standard. Wärmebrücken stellen lokal begrenzte wärmetechnische Schwachstellen in der Gebäudehülle dar, die durch einen verstärkten Wärmeabfluss zu erhöhtem Wärmeverlust und niedrigeren raumseitigen Oberflächentemperaturen führen. Die Berücksichtigung der Wärmebrücken ist von grundlegender Bedeutung für die Gebäudeenergiebilanzierung und wird in DIN V 4108-6 und DIN V 18599-2 beschrieben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Berücksichtigung des Wärmeverlusts über Wärmebrücken, wie pauschalierte Zuschläge (Wärmebrückenzuschlag ∆UWB) oder die Ermittlung von Y-Werten bei linienförmigen Wärmebrücken, wie dem Fensteranschluss.
Es gibt fünf Möglichkeiten, den Wärmeverlust über Wärmebrücken zu berücksichtigen, die in der DIN V 4108-6 und in DIN V 18599-2 beschrieben sind. Seit 2019 wird für den Wärmebrückenzuschlag ΔUWB nach DIN V 18599-2 zwischen den Kategorien "A" und "B" unterschieden. Kategorie "B" ist hierbei als höherwertig einzustufen. Die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung sind ebenfalls zu erfüllen.
Es gibt fünf Möglichkeiten, den Wärmeverlust über Wärmebrücken zu berücksichtigen, die in der DIN V 4108-6 und in DIN V 18599-2 beschrieben sind. Seit 2019 wird für den Wärmebrückenzuschlag ΔUWB nach DIN V 18599-2 zwischen den Kategorien "A" und "B" unterschieden. Kategorie "B" ist hierbei als höherwertig einzustufen. Die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 zur Vermeidung von Tauwasser- und Schimmelpilzbildung sind ebenfalls zu erfüllen.
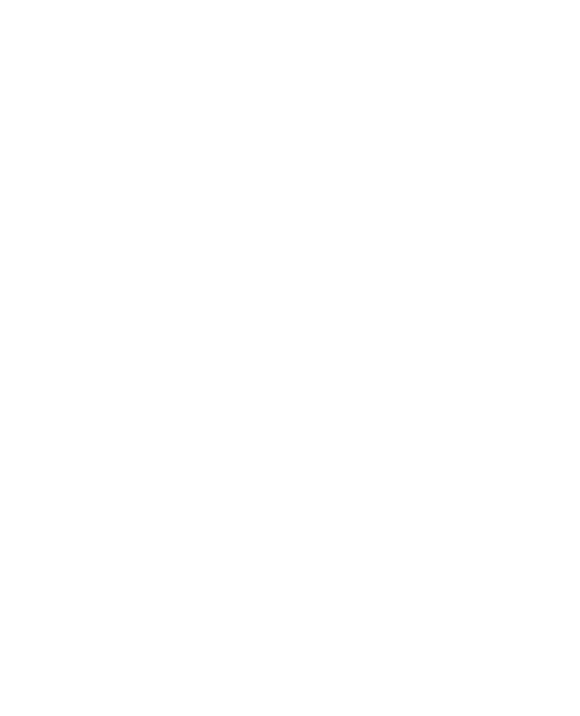
Um die Kennwerte schnell und effizient zu ermitteln, wurden die Tabellen im Montageleitfaden nach den aktuellen Normen überarbeitet. Neu hinzugekommen sind Tabellen zur Ermittlung der Y-Werte sowie die Möglichkeit, verschiedene Parameter wie die Ausführung der Überdämmung oder die Dämmung zweischaliger Mauerwände zu bewerten. Mithilfe der Musterdetails und der Tabellen können Gebäudeenergieberater, Fensterhersteller oder Monteure schnell die notwendigen Kennwerte ermitteln. Eine fundierte Montageplanung ist daher unerlässlich, insbesondere im Kontext der energetischen Sanierung des Gebäudebestands, um die Pariser Klimaziele zu erreichen.
6. Wärmetechnische Optimierung beim Fenstertausch
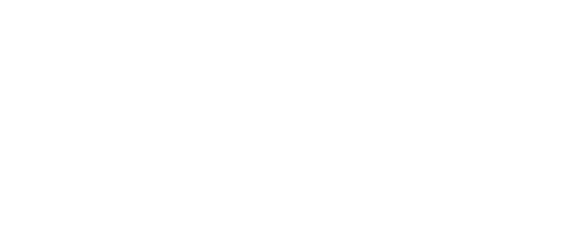
Im Zuge der Altbausanierung wird oft auf eine Planung durch einen Architekten oder Planer verzichtet. Stattdessen wird von Gebäudeenergieberatern oder Fensterherstellern bzw. Montagebetrieben erwartet, dass sie eine Baumaßnahme planen und dabei folgende Aspekte berücksichtigen:
Zunächst muss das bauphysikalische Gleichgewicht neu bewertet werden, da sich durch den Austausch der Fenster die Luftdichtheit und die Oberflächentemperaturen am Bauteil verändern können. Kritische Wärmebrücken sollten erkannt und durch Dämmung der Leibungen optimiert werden, insbesondere wenn der U-Wert der Außenwand UAW größer als 1,0 W/(m²K) ist. Auch mögliche Änderungen an baulichen Gegebenheiten wie Fensterbänken, Leibungen oder Rollläden müssen unter Berücksichtigung von Aspekten wie Denkmalschutz, Aufwand/Kosten und Vermeidung von Schmutz geplant werden.
Darüber hinaus muss die Nutzung und Zugänglichkeit während der Bauphase organisiert werden, einschließlich zusätzlicher Schutzmaßnahmen. Wenn mehr als 1/3 der Fenster in einem Gebäude ausgetauscht werden, muss gemäß DIN 1946-6 ein Lüftungskonzept erstellt werden. Bei einem Austausch von 10% der Fensterfläche sind der Nachweis für den sommerlichen Wärmeschutz und gegebenenfalls eine Verschattung notwendig.
Typische Situationen bei der Fenstererneuerung im Gebäudebestand
(a) Die Fenstererneuerung erfolgt in Verbindung mit einer (energetischen) Gesamtsanierung der Gebäudehülle (Idealfall).
(b) Beim Fensteraustausch wird die innere und/oder äußere Leibung erneuert (Fenstergrößen bzw. Glaslichten bleiben nahezu erhalten).
(c) Der alte Blendrahmen wird herausgeschnitten und das neue Fenster wird in die Putzlichte gesetzt (Fenstergrößen bzw. Glaslichten reduzieren sich, geringere Staub- und Schmutzbelastung).
(d) Der alte Blendrahmen wird „besäumt" und ein neues Fenster wird im Überschubverfahren eingebaut. Fenstergrößen bzw. Glaslichten reduzieren sich deutlich. Nur sinnvoll, wenn vorhandener Blendrahmen mit Anschlussfuge keine Wärmebrücke darstellt und die Substanz des verbleibenden Rahmens intakt ist.
7. Die neue DIN 4109, Schallschutz
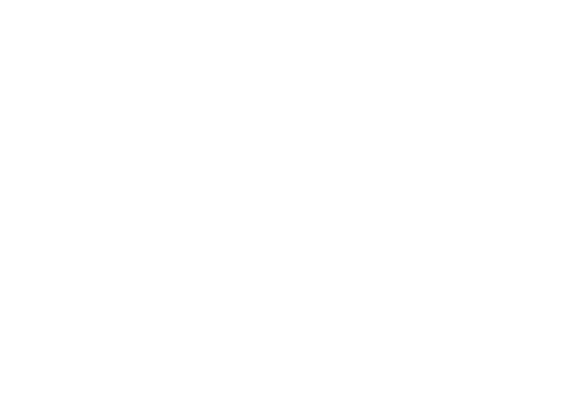
Die DIN 4109-2:2018-01 regelt die Anforderungen an die Schalldämmung von Fenstern und Bauteilfugen. Die Montagequalität spielt dabei eine entscheidende Rolle, um die geforderten Schalldämm-Maße zu erreichen. Gemäß Kapitel 4.4.4 der Norm müssen Fugen so geplant und ausgeführt werden, dass das bewertete Schalldämm-Maß des Fensters erhalten bleibt. Hierbei darf die Schalldämmung des Bauteils um nicht mehr als 1 dB reduziert werden.
In der neuen Ausgabe der DIN 4109 wird die Mindestanforderung an die Luftschalldämmung von Außenwandbauteilen nicht mehr tabellarisch in sieben Lärmpegelbereiche eingeteilt, sondern durch eine Rechengleichung ersetzt, die eine präzise Auslegung ermöglicht. Der Nachweis für das gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R'w,ges umfasst die Schalldämmung von Wand, Fenster und Fuge. Eine Unterscheidung zwischen Prüfwert Rw,P und Rechenwert Rw,R gibt es nicht mehr.
Bei der Fugenausbildung gilt als Faustregel, dass das Fugenschalldämm-Maß um mindestens 10 dB höher liegen sollte, als die geforderte Schalldämmung des Bauteils, um die 1 dB-Regel einzuhalten. Bei schalltechnisch kritischen Einbausituationen gemäß DIN 4109-2, Kap. 4.4.4 sind Planer besonders gefordert. Hier ist ein planerischer Nachweis der Einbausituation erforderlich und es müssen besondere Maßnahmen geplant und entsprechende Vorgaben gemacht werden. Der Montageleitfaden enthält hierzu ausführliche Informationen und eine Tabelle zur Ermittlung der Fugenschalldämmung.
Bei der Fugenausbildung gilt als Faustregel, dass das Fugenschalldämm-Maß um mindestens 10 dB höher liegen sollte, als die geforderte Schalldämmung des Bauteils, um die 1 dB-Regel einzuhalten. Bei schalltechnisch kritischen Einbausituationen gemäß DIN 4109-2, Kap. 4.4.4 sind Planer besonders gefordert. Hier ist ein planerischer Nachweis der Einbausituation erforderlich und es müssen besondere Maßnahmen geplant und entsprechende Vorgaben gemacht werden. Der Montageleitfaden enthält hierzu ausführliche Informationen und eine Tabelle zur Ermittlung der Fugenschalldämmung.
8. Fenstermontage in hochwärmedämmendem Mauerwerk
In den letzten Jahren wurden Steine für monolithisches Mauerwerk wärmetechnisch optimiert, indem die Stege dünner und der Lochanteil größer wurden, um den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) gerecht zu werden. Dies führte jedoch zur Reduzierung der mechanischen Festigkeit, insbesondere der Dübeltragfähigkeit im Leibungsbereich. Daher gestaltet sich die Befestigung von Fenstern mit herkömmlichen Methoden zunehmend schwieriger. Das ift Rosenheim hat im Rahmen eines Forschungsprojekts Empfehlungen für die Befestigung von Fenstern entwickelt, wie zum Beispiel die Verwendung von Leibungssteinen mit größerer Wanddicke oder die Verteilung von Lasten durch zusätzliche Befestigungspunkte.
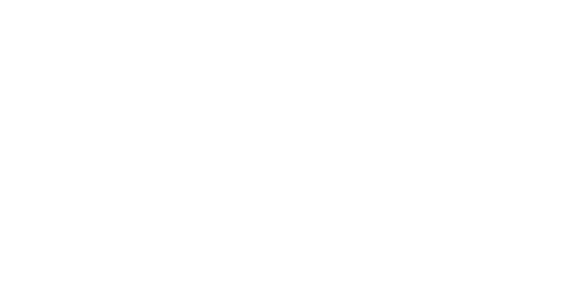
Gleichzeitig steigt auch das Gewicht transparenter Bauelemente aufgrund von Dreifachglas, größeren Glasflächen sowie höheren Anforderungen an Komfort (Schallschutz) und Sicherheit (Einbruchhemmung) erheblich an. Zum Beispiel ist eine P4A-Scheibe für ein Fenster mit der Einbruchklasse RC2 um 50% schwerer (45 kg/m² statt 30 kg/m²). All dies führt dazu, dass die allgemeinen handwerklichen Empfehlungen für eine ausreichende Befestigung bei hochwärmedämmendem Mauerwerk nicht mehr ausreichen. Es ist auch wichtig, die Wirkungsrichtung der einwirkenden Kräfte und der daraus resultierenden Auflagerkräfte (in oder rechtwinklig zur Fensterebene) zu beachten. Eine Analyse der an den Befestigungspunkten auftretenden Lasten zeigt einen erheblichen Einfluss der Belastungsart und des Fensterformats.
Die im F&E-Projekt durchgeführten Bauteilversuche haben gezeigt, dass eine dauerhafte Befestigung grundsätzlich möglich ist, insbesondere in Leibungssteinen mit optimierter Befestigungszone. Hierbei wurden auch neue Befestigungskonzepte für örtliche Lastkonzentrationen berücksichtigt. Folgende Hinweise sind zu beachten:
• Eine durch das Befestigungsmittel abzutragende Last infolge Windeinwirkung kann prinzipiell durch die Verwendung von mehreren, gleichmäßig verteilten Befestigungspunkten reduziert werden.
• Die örtlich auftretenden, horizontalen Lasten aus dem Eigengewicht des geöffneten Fensterflügels nehmen mit der Elementbreite, insbesondere bei ungünstigen, liegenden Formaten, überproportional zu (im Beispiel bei B:H = 2:1 um fast 300 %).
• Bei einer zusätzlich am geöffneten Fensterflügel zu berücksichtigenden vertikalen Nutzlast P von 600 N liegt für alle Abmessungen die durch das Fensterflügelgewicht und die Nutzlast P verursachte horizontale Last signifikant höher als die Last durch Windeinwirkung. Dies gilt für eine umlaufende und für eine zweiseitige Befestigung.
• Eine durch das Befestigungsmittel abzutragende Last infolge Windeinwirkung kann prinzipiell durch die Verwendung von mehreren, gleichmäßig verteilten Befestigungspunkten reduziert werden.
• Die örtlich auftretenden, horizontalen Lasten aus dem Eigengewicht des geöffneten Fensterflügels nehmen mit der Elementbreite, insbesondere bei ungünstigen, liegenden Formaten, überproportional zu (im Beispiel bei B:H = 2:1 um fast 300 %).
• Bei einer zusätzlich am geöffneten Fensterflügel zu berücksichtigenden vertikalen Nutzlast P von 600 N liegt für alle Abmessungen die durch das Fensterflügelgewicht und die Nutzlast P verursachte horizontale Last signifikant höher als die Last durch Windeinwirkung. Dies gilt für eine umlaufende und für eine zweiseitige Befestigung.